PLUG-IN OHNE
DROP OUT
Simulation einer Hirnstimulation
The Brain is the
Screen.
Gilles
Deleuze
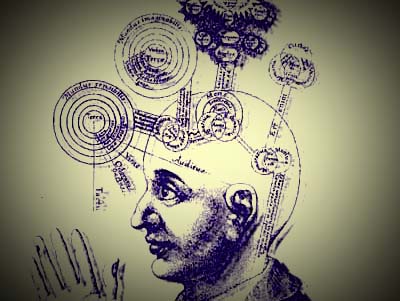
Schnittstelle
»Das letzte Jahrzehnt des Jahrtausends wurde vom US-amerikanischen Kongreß
mit einem milliardenschweren Forschungsprogramm zum Jahrzehnt des Gehirns,
zur ›Decade of the Brain‹ erklärt.«
Neben dem philanthropischen oder, sagen wir, rein medizinischen Anliegen,
effizientere Operations- und Heilmethoden zu entwickeln, richtet sich ein
stärker werdendes Interesse auf die Entwicklung eines kybernetischen
Kommunikationssytems. Gesucht wird ein Interface, daß sich hinter den
Augen und Ohren einklinken läßt.
Das ist der Wunschtraum, beinahe schon ein Mythos der 90iger, stets infiltriert
von der Realität gerade entwickelter Apparate. Unter dem technologischen
Make-up dieses Traums verbirgt sich der Wunsch nach dem Sichtbar-Machen menschlicher
Gedanken: ein Bestreben, das zur Genese der Mnemotechnik gehört und sich
in den parawissenschaftlichen Lehren vom Übersinnlichen voll entfaltet.
Konkret und nüchtern taucht heute dieser Wunschtraum im Verlangen nach
schnellstmöglich vermittelbarem Wissen auf. Kein speed-reading oder Crashkurs
in Algebra, sondern menschliches Wissen, assimiliert von künstlicher
Intelligenz (KI) und vice versa: Einstein als Unix Software.
Die Versuche, den seelenlosen digitalen Apparate durch militärischen
Drill zu eigenständiger Intelligenz zu verhelfen, gerieten mitunter ins
Stolpern. In den KI-Laboren knallen jedenfalls weniger Sektkorken als vor
20 Jahren.
Mehr Turbulenzen erzeugen zur Zeit die Unternehmungen, die in entgegengesetzter
Richtung wirken: zurück zum Hirn. Die Suche nach einem künstlichen,
zerebralen INPUT hat eine ganze Reihe angenehmer und unangenehmer Nebenerscheinungen
freigesetzt.
Die Infotainmentmärkte mit ihren inzwischen kaum noch beanstandeten Reizüberflutungen
diktieren die Aggressivität, mit der – erstaunlich genug –
immer noch nach möglichen neuen trompe l’oeils gesucht wird. Da
man den Augen kaum etwas vormachen kann, erscheint die Konsequenz, die Bildinformationen
als kodierte Botschaft direkt an das Großhirn zu senden, durchaus plausibel
(zumindest aus der Sicht bissiger Werbestrategen und Medienmacher).
Doch das ist bis dato ebensowenig Realität, wie auch immer noch unklar
ist, wieviel künstlich vermittelte Information man überhaupt auf
ein Hirn loslassen kann.
Die folgenden Ausführungen liefern einen historischen Abriß über
neurophysiologische Experimente mit verschiedenen Rezeptionsmanipulatoren.
Wissenschaftliche, philosophische und rein fiktionale Thesen und Experimente
werden ausgewählten künstlerischen Ansätzen gegenübergestellt.
Darüberhinaus sollen Sinn und Anwendbarkeit der jeweiligen Konzepte untersucht
werden.
Die Beispiele werden so Material eines imaginären Testversuchs: Tauglichkeit
eines Kinos, welches das Auge umgeht. Die Verbindung zum Kino – zunächst
nur eine unter vielen denkbaren – erscheint schlüssig, um ein konventionelles
Darstellungsmedium an etwas Nicht-Darstellbaren arbeiten zu lassen. Als »Neurocinema«
wurde dieses Medium konsequenterweise schon andernorts betitelt.
Man stelle sich nun vor, daß in eine vermittelte Information eine Art
Bewertung impliziert wurde; z.B. könnte das eine emotionale Komponente
sein, die an diesem Stückchen Information haftet. Die Frage nach der
Bewertung bringt einen ästhetischen Faktor ins Spiel, der wiederum über
das künstlerische Potenzial des Mediums nachdenken läßt: ein
einzelner von mehreren Bereichen, die sich in der Idee des »Neurocinemas«
zusammenfinden.
Warum in der Medienkunst schon etwas einen Namen hat, was es noch gar nicht
gibt, liegt an der ihr eigenen Natur, stets mit Technologien zu experimentieren,
die noch in den Kinderschuhen stecken. Medienkunstprojekte mit innovativem
Ehrgeiz sind anfällig für Exkurse in unerforschte Terrains, insbesondere
auf dem Gebiet der synästhetischen Vermittlung. Manche mit schmerzhafter
Kurzlebigkeit, zumindest was bestimmte Kategorien betrifft: Das Konglomerat
»Multimedia« wird unter Kunstkuratoren mittlerweile als Schimpfwort
gehandelt.
Auf der anderen Seite fördert die Vereinfachung von Programmiersprachen
und die mediale Öffnung des Internets die Entstehung neuer interaktiver
Kunstprojekte. Eine direkte Interaktion zwischen Kunstwerk und Hirn würde
eine neue Maxime der interaktiven Kunst entstehen lassen: eine schier uneingeschränkte
Handlungsebene, bei der es keine Zuschauer mehr gibt, sondern nur noch aktive
Co-Produzenten.
Friktion, Fiktion
und LSD
Was genau kann man da oben manipulieren? Diese Frage wurde schon Ende der
50er Jahre nachdrücklich gestellt. Gibt es beispielsweise effektivere
Hirnstimulationsmaschinen als jene Walkmänner, die den Ohrläppchen
eines Drogenabhängigen ziepende Elektroimpulse verpassen?
Ohne Zweifel: Je präziser stimuliert werden kann, desto mehr Übles
werden diese Verfahren anrichten. Zu allererst erinnert das an die schon längst
existierenden neuralen Konditionierungsversuche, allerdings immer im Zwielicht
wissenschaftlicher Effizienz: von Hypnose zu Hirnwäsche, Lügendetektor
zu Gedankenlauschen, etc..
Schon im Vorfeld der Realisierung einer neuralen Schnittstelle – wie
immer diese aussehen mag – hat sich ein heftiger ethischer Diskurs entzündet,
der neben der schon lodernden Genmanipulationskritik ganz offensichtlich eine
sehr viel turbulentere BioTech-Debatte heraufbeschwören wird: alles mit
dem Beigeschmack einer aus politischen Gründen populärwissenschaftlich
geführten Diskussion voller Auslegungen und Verallgemeinerungen, die,
würden wir näher auf sie eingehen, jeden nachfolgenden Gedanken
wie einen Granitklotz im Fluß versinken lassen würden.
Da ist es wieder: Das ambivalente Gefühl, welches sich einstellt, wenn
man gezwungenermaßen eine politische Reflexion temporär suspendiert.
Doch gerade das ist in gewisser Weise unumgänglich, um zumindest künstlerische
Ansätze ohne moralische Bremskräfte weiterentwickeln zu können.
Neurale Stimulierungsversuche erinnern an die Tage der euphorischen Bewußtseinserweiterungs-Liga
um den Guru Timothy Leary, an einen bittersüßen Geschmack auf der
Zunge, an LSD, an Halluzinogene und an Hirnvisionen, wie man sie nicht hätte
träumen können. Im Vergleich zu den heutigen Anstrengungen wirken
die durch Halluzinogene hervorgerufenen Rauschzustände und die analytischen
»Reiseberichte« der Probanden wie die ersten brachialen Tests
einer irrsinnigen, jedoch zukunftversprechenden Wissenschaft. Die Rauschwirkung
selbst gleicht einem unmanöverierbaren Flugzeugprototypen ohne Höhen-
und Seitenruder und ist allein durch einen geistigen ›reset‹ abschaltbar:
Ausstieg nur mit Schleudersitz.
Wenn es um die Funktionalität der Wahrnehmung geht, schaffen Neurophysik
und Psychologie nur unwillig wissenschaftliche Ergänzungen in der Zwischenwissenschaft
Psychophysik. Ein idealer Bereich, der Wissenschaften des Übersinnlichen
und Spirituellen wie Schweißperlen aus den Poren der überhitzten
Forscher und Denker heraustreten läßt.
Die mittelalterliche Tradition der Seher findet hier eine Entsprechung in
der Kommunikations-»technik« ESP (Extra-Sensual-Perception). Aus
wissenschaftlicher Perspektive ist dies nichts weiter als salonfähig
gemachte Schizophrenie. Wo immer ein Restraum von Unbestimmbarkeit bleibt,
wird Wissenschaft unfreiwillig verzerrt. In genau diesem Bereich kann sich
allerdings ein künstlerisch wertvolles Substrat entwickeln. Es stellt
sich oft heraus, daß nur die virtuose Simulation einer Idee – mag
sie sich von faktischer Belegbarkeit auch weit entfernen – dieses Substrat
in etwas Eigenständiges verwandelt.
Der schwierig definierbare wissenschaftliche Grenzbereich zwischen Physik
und Psychologie wurde von David Finkelstein und noch einmal ganz anders von
Otto Rössler als »Physik von Innen« oder Endophysik umschrieben.
Da ist keine New-Age-Mystik am Werk, sondern eine selbst-reflexive Vorgehensweise,
bei der man »alle physikalischen Fragen zweimal beantworten muß,
einmal unter Annahme, daß man privilegiert ist (von Außen) und
ein zweites mal so, daß man sich als Teil des Systems begreift (von
Innen)« .
Mit letzterem haben wir es in diesem Zusammenhang wortwörtlich zu tun.
Ein Hinterfragen des »Innen« führt uns auf eine Schliche
des Bewußtseins. Wir durchforschen das wichtigste Steuerorgan unseres
Körpers. Genau das, was diesen Gedanken produziert. Das Hirn ist in der
Lage, Unternehmungen selbst-referenziell zu simulieren, uns freizügigerweise
sogar das Gedankenbild einer möglichen Manipulation zu liefern.
Zwingt der langsam hereindonnernde Jahrtausendbeginn zu einer verschärften
Konjunktur der (noch nicht) existierenden Technologien?
Das spekulative Medienrauschen steht unter dem sich selbst auferlegtem Druck,
bestimmte Versprechen von Technologien für dieses Jahrtausend einhalten
zu müssen, was dazu führt, daß viele wunderbare Phantasmen
produziert werden. Gleichzeitig ist das Thema geradezu prädestiniert,
faktisch zu entgleisen. Unwissenschaftliche Spekulationen über neurophysiologische
Experimente (inklusive der hier vorliegenden) lassen Reales und Irreales schnell
und undifferenziert zu einem klebrigen Konglomerat zusammenschmelzen. Ein
alchemistisches Amalgam, oszillierend zwischen Science und Fiction. Im negativen
Fall entstehen Zukunftsvisionen wie die der Mediengiganten Sony und Bertelsmann.
Im positiven Fall potenziert sich das Grundwissen zu gewaltigen Visionen,
wie in den Werken von Arthur C. Clarke oder William Gibson. Sie haften erschreckend
nahe an der realen technologischen Entwicklung ihrer jeweiligen Zeit. Wenn
auch als pure Fiktion, formulieren sie nicht nur das plausible Erscheinungsbild
der Zukunftstechnologien, sondern betten sie präzise in einen gesellschaftspolitischen
Kontext ein.
In der Boulevardpresse operiert man dagegen weitaus unmoralischer. Technologien
»von morgen« werden stilisiert, fetischisiert und kurzum in Wissenschaftspornographie
verwandelt. Der Kölner Physiker Günther Nimtz beispielsweise hat
in einem Versuch Schallwellenübertragungen von 100-facher Lichtgeschwindigkeit
gemessen. Der Versuch kitzelt am Raum-Zeit-Kontinuum, jedenfalls wenn man
der Darstellung der Medien glauben will, die ihn prompt als ersten Beweis
der Möglichkeit einer Zeitreise missverstehen.
Auf raffinierte Weise verstecken Autoren die Konjunktivform in solchen wissenschaftlichen
Reportagen.
Im Januar berichtet z.B. der Brite Kevin Warwick, der mit dem Department für
Kybernetik an der Universität in Reading zusammenarbeitet, in der amerikanischen
Zeitschrift Wired von einem kleinem Interface im Glasröhrchen, das er
sich in den Arm implantieren läßt, und womit er das gesamte Nervensystem
anzapfen ›könnte‹. Sein Experiment klingt schon deshalb stimulierend
realitätsnah, weil Warwick stolz berichtet, wie er sich zuvor tatsächlich
schon einmal ein Teströhrchen hatte implantieren lassen. Dieses war aber
zu nicht viel mehr in der Lage, als seinen eigenen Standort zu senden. Mit
dem »in nur wenigen Monaten folgenden« neural aktiven Implantat
spielt nun Warwick das Filmscript des 80er Jahre Sci-Fi-Thrillers »Projekt
Brainstorm« nach.
HirnPioniere
und GeistGoldgräber
Im Raum steht die Hypothese, daß »da oben etwas angekitzelt oder
abgerufen werden kann, was bislang noch verborgen geblieben ist.«
Phrenologie, die älteste Kartographie der Hirnregionen, war deshalb ein
so abenteuerlicher Wissenschaftszweig, weil die technische Unzulänglichkeit
der Meßinstrumente eine Vielzahl von Forschungsergebnissen hervorbrachte,
die zwar einander widersprachen, aber gleichzeitig nur schwer zu widerlegen
waren. Selbst heute herrscht nach wie vor eine Art Goldgräberstimmung,
behaupten Neurologen.
Die von Franz Gall um die Wende zum 19. Jahrhundert eingeführte Phrenologie
hat inzwischen rein historische Bedeutung, da sie sich mehr oder weniger als
ein wildes Ratespiel entpuppte.
Ein Jahrhundert zuvor stellte sich René Descartes das Hirn als ein
Steuerzentrum vor, das sich extern vom menschlichen Körpers befindet,
in einer separaten Sphäre des materiellen Universums. Einer Art individueller
Radioempfänger, der gleichzeitig eine Verbindung von Bewußtsein
und Materie herstellte. Descartes erkannte, daß zum Sehen eine Seele
gehört. Später wurde sie in einem der dicken Knoten hinter dem Sehnerv
vermutet . Über Jahrhunderte haben Neurologen zwar immer mehr Organe
und Hirnbereiche entdeckt, die mit am Rezeptionsprozeß beteiligt sind,
trotzdem ist das System immer noch unvollständig detektiert.
Gulliaume Duchenne injizierte elektrische Spannungen, die seine Patienten
Fratzen schneiden ließ und belegte damit, daß Nervenaktivität
auf elektrodynamischen Impulsen basiert. (Darauf besitzt der australische
Performancekünstler Stelarc ein künstlerisches Copyright.)
Es wurde weiter gebohrt und gestochert. Zahllose Menschenhirne wurden während
der Französischen Revolution und des ersten Weltkriegs seziert und auf
illustre Weise auf mögliche Funktionen hin untersucht. Leider läßt
sich wenig aus leblosen Hirnen herauslesen. Nach über einem Jahrhundert
nahm man immer noch an, daß jeder Körperfunktion nur ein einzelner
Hirnbereich zugeordnet sei. Erst mit dem amerikanischen Neurologen Karl Lashley
kam die Wende.
Lashley bewies die Masseninteraktionen der Neuronen, und somit, daß
bestimmte Prozesse sich nicht in einzelnen Hirnregionen lokalisieren lassen.
Der kanadische Neurochirurg Wilder Penfield , der die komplexesten Regionen
des Großhirns kartografierte, experimentierte als erster in den 50iger
Jahren mit der sogenannten ›direkten Hirnrindenstimulation‹. Er
brachte Elektroden in verschiedenen Hirnregionen epilepsiekranker Patienten
an. Die Stimulation an den seitlichen Gehirnlappen triggerte vor allen lebhafte
Kindheitserinnerungen bei den Patienten. In den Protokollon beschreiben sie
eindeutige, klare Bilder, so als hätten sie geträumt: »Ich
sah und hörte meine Mutter…« Penfield war in der Lage das
exakt identische Erinnerungsbild mehrmals abzurufen. Er konnte die zwar nicht
die genaue Art der sogenannten Engramme lokalisieren, aber das machte das
Experiment nicht weniger sensationell, war es doch gleichermaßen unheimlich
und unethisch: Mnemotisches Klavierspielen auf der Erinnerungstastatur anderer
Menschen.
Wetware. Where?
Der Schweizer Kunstkurator René Stettler nennt den Grund für solche
innovativen Anstrengungen »ein Schnittstellenproblem mit der Welt «
Auf dem von ihm 1995 in Luzern organisierten Symposium »Gehirn, Geist,
Kultur« beschreibt er folgendes:
»Der Hirnforschung wurde (in den 90er Jahren) Priorität vor allen
anderen Wissenschaften eingeräumt. Der Grund für das wachsende Interesse
an den Neurowissenschaften ist die Einsicht, daß Nervensysteme für
fast alle denkbaren Probleme der Informationsverarbeitung, einschließlich
der Organisation von Entscheidungsprozessen, weitaus effizientere Lösungen
gefunden haben, als die bisher vom Menschen konzipierten künstlichen
Systeme. Dies läßt nach der Meinung von Hirnforschern erwarten,
daß Erkenntnisse über die Funktionsweise von Nervensystemen umgesetzt
werden können in die Funktion von Apparaten, die leistungsfähiger
und besser handhabbar sind als herkömmliche Computersysteme.«
Denkt man Stettlers Theorie – die schon dabei ist, Wirklichkeit zu werden
– im Hinblick auf die Entwicklung eines Interfaces weiter, so scheint
es unumgänglich, daß die bestehende Computer-Hard- und Software
zugunsten der »Wet«-ware umentwickelt werden muß. Um überhaupt
kommunizieren zu können, muß eine künstliche Sende- und Empfängereinheit
auf einer Struktur arbeiten, die mit der des Gehirns korrespondiert. Demnach
wird es keinen Bio-Digital- Adapter geben, sondern eine Hard/Software mit
auf Halbleiterbasis interagiereden Neuronen, genannt »Siliziumneuronen«
Die Hardware eines solchen Biocomputers wird gerade vom M.I.T. und den Bell
Labs/Lucent Technologies entwickelt. »Forscher haben erstmals Schaltkreise
konstruiert, die zwei wesentliche Eigenschaften biologischer Neuronen aufweisen:
Die digitale Auswahl von Reizen und die analoge Verstärkung der Reaktion
auf bestimmte Reizeigenschaften.«
Friedrich Kittler hat am Beispiel der Erfindungen medientechnologischer Wegbereiter
des vorletzten Jahrhunderts Ähnlichkeiten aufgezeigt bezüglich ihrer
Reversiblität in der Anwendung: ein Mikrophon war gleichzeitig ein Lautsprecher;
die Retina-Adaption ›Film‹ konnte genauso speichern und wiedergeben,
wie die phonographische Zackenschrift den Ton, etc..
Werden Neuro-Schnittstellen ebenso in beide Richtungen funktionieren? Eine
berechtigte Anwenderfrage, entscheidend bei der Erschaffung eines Betriebssystems
auf digital-neuraler Plattform. Zumindest wissen die Forscher jetzt genug,
»um auf die Art zu rechnen, wie es die Biologie tut«, behauptet
sehr optimistisch Rajesh P.N. Rao vom Salk Institute of Biological Studies
in Kalifornien.
Wenn man direkt die Hirnrinde stimulieren will, so ist allerdings nicht einmal
der genaue Angriffspunkt festzulegen. Genaugenommen ist die Fragestellung
allerdings auch nicht ›wo?‹, sondern ›wo gleichzeitig?‹.
Wie gelangt man beispielsweise an den Thalamus, das Weichenstellwerk im lymbischen
System, über das alle Sinne (bis auf den Geruch) an die Sinneszentren
weitergeleitet werden? Eine physische Verbindung als Schnittstelle ist dort
ohnehin auszuschließen. Wohl nirgendwo anders wurde darüber so
viel phantasiert, wie in den Filmen »Matrix« und »Existenz«.
Es handelt sich um eine kleine Buchse, die mit Preßluft einmalig ins
Rückenmark oder in den Hinterkopf gepfropft wird, im Film ein kleiner
Eingriff, kaum dramatischer als ›body piercing‹. Wissenschaftler
nennen die materielle Seite des Übertragungsproblems den »Hardware/Wetware
Gap«.
Die Sehinformation wird im visuellen Kortex verarbeitet, der sich am Hinterkopf
befindet. Verschiedene Unterbereiche zerlegen den Akt des Sehens unter Aspekten
wie Stereoskopie, Tiefe und Distanz, Farbe, Bewegung, Bestimmung der Position
des Objekts. So viele Unterteilungen einer Sehinformation muß ein ZNS
also bündeln und zerlegen können. Wie die Bauhaus-Bühnenpartituren
von Laszlo Moholy-Nagy müßten wohl die Übertragungsprotokolle
dieser kombinierten Signale aussehen. Daß man extern individuelle Reize
aufzeichnenkann, ist mittlerweile bewiesen.
Am Biological Imaging Center des C.I.T. arbeitet Steve Potter an einem ersten
bidirektionalen Multikanal-Interface und mißt alle möglichen Reizreaktionen
mit einem Biochip, welcher mit Neuronencluster in herangezüchteten tierischen
Hautzellen korrespondiert. Ohne Augen Sehen: Pixelvision
Interessanterweise adaptiert das Gehirn jegliches Perzeptionssystem als alternativen
Sehsinn und zwar unabhängig von dessen spezifischen Qualitäten.
Ein einleuchtender Beleg dafür ist die Fähigkeit zum Ausbalancieren
einer Sehschwäche. So können blinde Patienten eine Art taktile Sehtechnik
entwickeln. Auf dem Rücken von Blinden wurde ein Raster mit elektromagnetischen
Impulsgebern installiert. Eine Videokamera ist auf einer Spezialbrille (also
in Augenhöhe) angebracht und das Videobild wird auf dem Rücken in
spürbare Elektoimpulse zerlegt. Das in Form einer sehr groben Kontrasttrennung
ausgegebene Bild kann so »gelesen« werden. Schon bald adaptieren
die Patienten die Tastinformation als reine Sehinformation, die Elektroimpulse
sind also aus dem Bewußtsein gerückt und der »point of view«
verlagert sich vom Rücken direkt auf die Kamera. Die Patienten können
sich ohne fremde Hilfe in unvertrauten Umgebungen bewegen, Räume und
Durchgänge wahrnehmen.
Daß dieses Experiment keine generelle Anwendung findet, liegt daran,
daß es nicht im Dauerbetrieb funktioniert. Das komplizierte menschliche
Wahrnehmungssystem läßt sich nur für kurze Zeit umleiten,
bevor es überbelastet wird und ein schmerzendes Warnsignal auslöst.
Kinematographische Sehexperimente mit Stereoskopie bringen dieselben unangenehmen
Nebenwirkungen. Anaglyph 3-D: Kopfschmerzen. Polarisation 3-D in Farbe: Kopfschmerzen.
Virtual Reality Helme mit 3-D System: Kopfschmerzen. Nur deshalb hat sich
keines dieser ausgeklügelten Verfahren im Kino durchsetzen können.
Letztendlich ist es immer das Bewußtsein, welches einen Strich durch
die Rechnung macht. Ein Doppelbetrug, der nicht funktioniert. Denn im 3-D
Kino mit Brille oder unter einem Virtual Reality Helm ist man sich stetig
des Simulations-Charakters bewußt, obwohl dem Auge das Bild als Realität
suggeriert wird. Die schlechte Qualität der VR-Sichtmonitore trug dazu
bei, daß diese Technik ohnehin sehr schnell unpopulär wurde.
Weltweit arbeiten mehrere Forschungslabore schon seit knapp 10 Jahren an zwei
verschiedenartig funktionierenden Retina-Implantaten für Blinde. Es wird
untersucht, ob ein Videosignal verläßlich »transcodiert«
werden kann. Das Team um Rolf Eckmiller vom Neurologischen Institut der Universität
Bonn montiert eine Videokamera ebenfalls auf einer Spezialbrille.Diese korrepondiert
über eine Laser-›link‹ mit einem hauchdünnen Silikonchip,
welcher direkt auf die Retina des blinden Patienten implantiert wurde.
Winzige Stromstöße leiten die von Photodioden gelesene Sehinformation
an die benachbarten Neuronen. Für die ersten Versuche benutzte man eine
Kaninchenretina, bei der man die injizierte elektrische Stimulationen mit
der optischen verglich und so anhand der Meßergebnisse die Funktionsweise
studierte.
Wie uns der Filmemacher und Künstler Heinz Emigholz mit einer Szene in
seinem Film “Normalsatz” erinnert, war es ebenfalls eine Kanninchenretina,
die von dem Wissenschaftler Willy Kühne 1878 in Feinstarbeit konserviert
fotochemisch fixiert wurde. Kühne lieferte das erste Indiz für ein
von einem Tier gesehenes Bild. Die konservierte Retina zeigte in starker Verzerrung
ein Fenster, das in die Retina des noch lebenden Kaninchens gebrannte Nachbild:
das letzte Bild, welches das Tier unmittelbar vor seinem Tod erblickte.
Die Erfolge der einzelnen Forschergruppen sind unterschiedlich. Anders als
bei dem von Eckmiller entwickelnden Retinaimplantat haben John L. Wyatt und
Joseph L. Rizzo (M.I.T. und Havard) in ihren Forschungsprojekt die Retina
übersprungen und stimulieren direkt den Sehnerv mit einer unabhängig
funktionierenden, »epiretinalen Prothese«. Der entscheidende erste
Schritt der Sehverarbeitung wird hierbei übersprungen und simuliert .
Es ist immer noch nicht geklärt, was im letzten Schritt des Sehprozesses
tatsächlich geschieht. »Der bleibt wohl immer der Seele überlassen«,
gesteht Eckmiller, denn, »wenn Sie uns Neurologen fragen, was visuelle
Wahrnehmung ganzheitlich bedeutet, so ist die Antwort: Wir wissen es nicht!«
Wie sieht das künstlich übertragene Bild aus? Es ist wohl kaum identisch
mit einem vom Auge übermittelten. Wim Wenders Version in »Bis ans
Ende dieser Welt« (1991) zeigte Etwas in zitronengelb, das an ein Technomusikclip
erinnert.
Eckmiller – dessen Technologie als einzige in Langzeitexperimenten Erfolge
zeigt – beschreibt, seine Patienten sähen »schemenhafte Umrisse«.
Am M.I.T. behauptet man dagegen optimistisch, es gäbe »ganz unscharfe
Schwarzweißbilder.« Ohne Zweifel eine höchst subjektive Angelegenheit.
Denn in diesem Fall beschreiben nicht die Sehenden den Blinden die Welt, sondern
umgekehrt.
Der wissenschaftlch-nüchtern klingende Report »unscharfe Schwarzweißbilder«
erinnert an die Wehen aller Geburtsstunden epochaler Meilensteine der visuellen
Technologie.
Namensgebung und Grundeigenschaften der Video-Technologie besitzen dabei eine
engere Verwandtschaft zum menschlichen Sehen, als die sehr viel ältere
Kinematographie und Photographie. Video wird durch elektromagnetischen Impulse
und ›augenblicklich‹ übertragen. Das Verfahren wurde von Vladimir
Zworykin 1923 unter dem Titel Ikonoskop entwickelt. 1925 führte John
Baird in England die erste Fernsehübertragung durch: beides kann als
ganz schemenhaftes, unscharfes Schwarzweiß angesehen werden.
In der Videokunst der frühen 90er Jahre gibt es eine interessante Parallele,
einen freiwilligen Rückzug in die Low-Tech-Ecke. Die ›Pixelvision
2000‹-Kameras begründeten für kurze Zeit eine neue Videoästhetik
und nach ihrem ebenso raschen Verschwinden fanden sie zum tatsächlichen
Jahrtausendwechsel eine Entsprechung in den ersten pixelgroben Webcastings
im Internet.Sinneseindruck
Das Kino hat verschiedenartige Versuche unternommen, Erinnerungen und Träume
darzustellen. Bei letzteren haben sich in der konventionellen Filmsprache
ganz eigene, realitätsfremde Regeln entwickelt. In den 50er Jahren hat
Hollywood surrealistische Stilelemente approbiert, und – wenn auch leicht
verkitscht – daraus filmische Zeichen und Codes entwickelt.
Ein solches Element ist die optische Unschärfe, die immer für die
vergessenen, nicht darstellbaren Elemente steht, welche sich in und um einem
Erinnerungbild ansiedeln. Das unscharfe Wabern den Sequenzüberleitungen
ist mittlerweile anerkannter Standard. In einem Kino für das Gehirn,
bzw. ›vom‹ Gehirn entfällt u.a. die Problematik der filmischen
Formatbegrenzung, denn es gibt keinen Rahmen oder Rand. Beim Versuch, ein
Erinnerungsbild zu beschreiben, bleibt dieser Aspekt vollkommen ungeklärt.
Die Tatsache, daß das Bewußtsein rigoros ausblendet, schleudert
uns von den mikro- in die makrokosmologischen Denkblockaden. Es scheint auch
sinnlos, nach Bildqualität und »Auflösung« zu fragen,
bzw. zu versuchen, sie mit jener von existierenden Bildträgern zu vergleichen.
Gedankenbilder in Super-8 oder in Cinemascope?
Ähnlich wie bei dem erwähnten taktilen System rückt bei visueller
Stimulation die Frage nach einer vom Gehirn kontrollierten Toleranz und Absolutheit
in den Vordergrund. Wenn erst einmal ein optisches System existieren würde,
welches das menschliche Auge und dessen Rezeptionsvermögen übertrifft
und das Material erfolgreich in den visuellen Kortex eingespeist werden kann,
würde man dann nicht ein Sehvermögen produzieren, welches tatsächlich
als eine qualitative Verbesserung empfunden wird? Wenn ja, dann hätte
das System ›Hirn‹ bereits den visuellen ›upgrade‹ mühelos
akzepiert und zum normalen Standard erklärt.
Zwischen einem hochauflösendem und ›drop-out‹-freien Videobild
und »gesehener« Information kann schon deshalb kein gültiger
Vergleich gezogen werden, weil das Videobild bislang nie das natürliche,
von der Retina erzeugte Bild ersetzen konnte, also alles immer noch einmal
durch die zweite, natürliche Sehinstanz lief. Ein verdoppeltes Verfahren,
bei dem erneut das Sich-Bewußt-Sein des Simulationscharakters eine wichtige
Rolle spielt. Auf technischer Seite ist nachgewiesen worden, wie unterschiedlich
Menschen sehen.
Die unbestimmte Zahl von Erfahrungswerten, die das Sehen beeinflussen, differenziert
der Neurologe Jean-Pierre Changeux als »Sinneseindruck«, und beschreibt
denselben als das »unmittelbare Ergebnis der Aktivität von sensorischen
Rezeptoren, während die ›Wahrnehmung‹ dem letzten Schritt vorbehalten
ist, der zur Identifikation des Gegenstands führt.« Je weniger
Erfahrungswerte vorliegen, desto weniger kann differenziert werden. Je abstrakter
der Inhalt des Gesehenen, desto eher wird auf ein ähnlich erscheinendes
Vorstellungsbild zurückgegriffen, das dem roh gesehenen »Perzept«
einen neuen Wahrnehmungsinhalt vermittelt. Das ist eine Grundvoraussetzung
für die Entstehung von optischen Täuschungen, ebenso wie von visuellen
Klischees. Eine Schliche des Gehirns, deren Verfahrensweise man mittlerweile
als elektronisches Erkennungssystem adaptiert hat.
Fehlt eine vergleichbares Gedankenbild, so kann das xenophobische Reaktionen
auslösen, wie etwa beim Betrachten eines vollkommen abstrakten Sehumfeldes.
Solche Reaktionen wurden schon häufiger bei Virtual Reality Experimenten
festgestellt. Interessant wird in diesem Zusammenhang wieder die Formatbegrenzung:
auf einem abstrakten Gemälde bleibt das Unentschlüsselbare hinter
einem Fenster (dem Bildrahmen) verborgen. Der Screen oder die Leinwand sind
ein sicherer Schutzwall und werden gleichzeitig als eine permanente Vergewisserung
des Virtualitätscharakters wahrgenommenen.
Das Hirn als
Schirm
Sehen ›ist‹ nichts anderes als Bewegung: die ›rapid eye movement‹,
sowie alle vollzogenen Lesebewegungen des partiellen Rezipierens. Die konstanten
Bewegungen des Auges bilden den Motor des visuellen Bewußtseins. Ein
Augenstillstand dagegen ruft gewöhnlich ein visuelles Transzendieren
hervor, eine Überblendung in ein durch verschiedene Reize hervorgerufenes
Erinnerungsbild.
Gilles Deleuze sieht in der Bewegung des Sehens ein weiteres Schlüsselelement,
bei dem die »Essenz des Bildes einen Gedankenschock produziert, die
Vibrationen an den Kortex vermittelt, dadurch das Nerven- und das zerebrale
System direkt berührt.«
Die komplexe philosophische Verwandtschaft zwischen Kino und Hirn ist seit
den Pionierjahren des Kinos Bild für Bild durchleuchtet worden.
Abgesehen von der Tatsache, daß kein anderes Medium nur annähernd
so gut das menschliche Sehorgan imitiert, ist es darüber hinaus im Stande,
ganze Denkprozesse in eine visuelle Form umzusetzen.
Erst mit der Montage der Bilder wird das Medium richtig unheimlich. Ein Schnitt
simuliert den Sprung eines Gedanken(bilde)s zum nächsten.
Henri Bergson sah im Kinematographen ein ganzes Modell menschlichen Bewußtseins.
Darauf aufbauend entwickelt Gilles Deleuze seine Kinophilosophie, ein »Cine-thinking«
, das das bewußte und unterbewußte Rezipieren von Film auf eigenwillige
und atemberaubende Weise völlig neu definierte.
Das Filmbild darf in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich als ein
schon einmal gesehenes Bild verstanden werden. Deleuze sind andere –
ontologische – Differenzen wichtig. Ein Filmbild ist ein Zeitbild und
ein Bewegungsbild. Das rezipierte Bewußtseinsbild des Gesehenen erschafft
ein hinzugedachtes, virtuelles Bild. Es kommt zu einer Überlagerung dieser
Bilder, bei der das optische Bild mit seinem virtuellen Gegenbild – wie
Deleuze es nennt – ›kristallisiert‹. Den unfixierbaren Charakter
des »Bewegungsbildes« (bis ins kleinste Filmkorn) vergleicht Deleuze
mit der sich ständig in hoher Geschwindigkeit bewegenden Molekularstruktur
des menschlichen Denkens.
Das experimentelle Kino hat sich um die Darstellung des menschlichen Sehprozesses
bemüht, einhergehend mit dem Anliegen, bestimmte Stilelemente des Hollywood-Kinos
aufzuheben. Theorien wurden im Medium selbst angewandt und aus ihnen eine
eigene Philosophie des Sehens entwickelt. Die wichtigsten Impulse gab höchstwahrscheinlich
Stan Brackhage’s ›Act of Seeing with one’s own Eye‹. In
ihm läßt sich die psychische Stimulation als eine direkte Rückkopplung
mit dem Gesehenen begreifen. Brackhage hat in seinem Filmen die Bewegungen
des Sehprozeß in eine filmische Choreographie verwandelt, Sehbares mit
quasi »Nicht-Sehbarem« überlagert. Bestimmte sukzessive Bildabfolgen
verdeutlichen die Immanenz des Vorstellungsbildes im Gesehenen: Die menschliche
Fähigkeit zurückzuprojizieren, auch in nicht selbst erfahrenen Bildern
denken zu können. Ein Phänomen, das in den »Nervous System
Performances« von Ken Jacobs ebenfalls zum Vorschein tritt oder beispielsweise
in der Videoarbeit von Cerith Wynn Evans, »Degrees of Blindness«,
zu finden ist. Fremde Bilder können erdacht werden, indem sie aus mehreren
Bausteinen zusammengesetzt werden, die aus dem unerschöpflichen Erinnerungsareal
stammen. Mnemotechnik ist ›found footage‹-Kino.
Die holländische Filmtheoretikerin Patricia Pisters behauptet, »das
Auge ist das Model für die abendländische Repräsentationsform
des Denkens. Das Gehirn steht für eine neue »rhizomatische«
(netzwerkartige) Art des Denkens. Die Hypothese ist, daß das Modell
des Auges nicht länger adäquat sei für das Verstehen und Interagieren
mit der Welt zum Ende des Zweiten Jahrtausends. Es sollte durch das Model
des Gehirns ersetzt werden.«
Patricial Pisters These belegt, daß die genannten Bestrebungen längst
als Metapher im zeitgenössischen Denken verankert sind. Gleichzeitig
kann man daraus folgern, daß hier ein neues Terrain betreten wird, das
nur bis zu einem bestimmten Grad vorexerziert bzw. simuliert werden kann.
Das Auge, das ›sieht‹, dominiert über die übrigen Sinne
(zumindest mehrheitlich in den abendländischen Kulturen, wie Pisters
betont.). Sehen wurde am komplexesten sprachlich reflektiert, intellektuell
am tiefsten durchdrungen. Doch da das Sehen nur ein Bestandteil einer synästhetischen
Interaktion ist, werden hier eine Fülle verschiedener Sinneskombinationen
offeriert, die aus genau dem genannten Grund sich der sprachlichen Fixierbarkeit
entziehen. Die Vielfältigkeit dieses unausgeschöpften Terrains suggeriert,
wieviel enger empirisches Forschen und künstlerisches Reflektieren zusammenfallen
könnten.
Peter Weibel bewegt sich schon lange in diesem symbiotischen Zwischenbereich.
Er formuliert mit der Idee des »Neurocinema« Positionen ganz unabhängig
vom Realisierungsstadium dafür notwendiger technischer Werkzeuge. Ironischerweise
hat deren Essenz ohnehin einen immateriellen Charakter. Gedanken zum Gedankenkino
bekommen eine andere Bedeutung.
Weibel definiert Technik als eine vom Menschen gemachte Natur, er benutzt
einen stark erweiterten Naturbegriff. Unter ihm ist das Neurocinema eine von
mehreren Subkategorien, die er in dem Oberbegriff »Genetische Kunst«
zusammenführt (und sich damit gezielt in eine ethischen Tabuzone bewegt).
Weibel geht es um die Schaffung eines Kunstverständnisses, »welches
nicht rein kunstimmanent bleibt, sondern sich den zentralen Punkten des Lebens
nähert. Technik (...) tritt in eine neue Phase, wenn sie zentrale Prozesse
des natürlichen Lebens in künstliche, vom Menschen gemachte verwandelt.«
Refektor
Außer bei den eingangs beschriebenen hirnwaschenden und gedankenkontrollierten
Horrorszenarios stellt sich bei mir als Videomacher und Produzent von Gedankenbildern
auch bezüglich des Neurocinemas ein Gefühl von Faszination und Schauer
ein. Die Kritik liegt auf der Hand: Der Fokus ist ganz auf eine elementare
Neudefinition von Kino und auf mediale Umorientierung gerichtet und läuft
so Gefahr, inhaltliche Kritik schlichtweg auszublenden. Es wäre zu fragen,
welche Faktoren – vor allen im künstlerischen Bereich – die
immerwährende Suche nach ›expaniderendem Kino‹, nach erweiternden
Kommunikationsformen überhaupt vorantreiben? Ausschlaggebend kann unmöglich
allein die vom Kunstmarkt anerzogene Sucht nach »Innovation mit allen
Mitteln« sein.
Wie ein Kartenhaus stürzt die innovative Leistung einer technischen Wegbereitung
in sich zusammen, wenn ihr Schöpfer eingestehen muß, daß
er (oder sie) das Werk nicht mit konkretem Inhalt füllen kann. Horror
Vacui in einer Welt ohne Einschränkungen. Glaubt man doch, der Grund
für jede mediale Erweiterung sei die Problematik, eine Idee in einem
einzelnen Medium zufriedenstellend umzusetzen.
Wäre »Neurocinema« eine Fortsetzung der multimedialen Kunst
mit anderen Mitteln, dann ist ihre Kritik auch eine Fortsetzung der nervtötenden
interdiziplinären Mediendebatten. Über die Möglichkeit des
Bilderproduzierens und die Unterschiede, die das Arbeiten mit Digital Video,
CD Rom, net.art oder Puppentheater hervorrufen. Bedeutung und Tiefe eines
Werkes treten hier erschreckend oft in den Hintergrund.
Nicht außer Acht zu lassen ist die Tatsache, daß es hier um das
Sichtbarmachen eines bislang unsichtbaren Operationsfeldes geht. Ein spektakuläres
Unternehmen, das Fragen zur Inhaltlichkeit aus seinen eigenem System katapultiert,
da die Idee des Präsentationsrahmens selbst zum Inhalt wird.
Es läßt sich momentan beobachten, wie lautlos ein bombastisches
Medienkunstkonstrukt nach dem anderen implodiert.
Der Rückzug in die neue Konzeptkunst, net.art, ist die entmaterialisierende
Konsequenz eines Technologie-surplus, mit der Ballast abgeworfen und ebenbürtiges
Baumaterial für den virtuellen Raum entwickelt wird. Kann, dieser Strategie
folgend, ein Neurocinema dem Simulations-Charakter eine neue Realität
einverleiben? Nicht im albernen Datenanzug, sondern im konventionellem Nervenkostüm
könnte man hier Ideen als Objekte wahrnehmen.
»Warum lacht ein Buddhist über jene westliche Philosophie, die
versucht Realität zu definieren?«
Knapp an Zen vorbei schliddere ich nun doch in die übersinnlichen Jagdgründe.
Man erinnere sich an die Schlußsequenz von Tarkowskis Film ›Stalker‹.
Der Philosoph und der Dichter stehen nach unendlichen Irrwegen vor jenem Raum
in der »Zone«, in dem alle Wünsche in Erfüllung gehen
sollen.
© 2000 Caspar Stracke
_______________
René Stettler: Gehirn, Geist, Kultur. Symposium für Wissenschaft,
Technik und Ästhetik, Neue Galerie, Luzern 1995
Bewußt ausgeklammert sind hier die »usual suspects«: Das
dominierendste Interesse ist ein kommerzielles, sowie das militärische,
welches zudem ein Paradox formuliert: Fördern und gleichzeitiges Ausbeuten
/ Zerstören von wissenschaftlichen Erneuerungen.
Peter Weibel: »Neurocinema«, Vortrag am Museum of Modern Art,
New York 1999, im folgenden Text genauer erläutert.
René Stettler, Interview mit Otto E. Rössler, Luzerner Vorlesungen
und Gespräche / Aktuelles Denken, Neue Galerie Luzern 1999
Zeitschrift »Wired«, 8.02, Mark Alesky, »Cyborg 1.0«,
S. 145 ff
Rita Carter, Mapping the Mind, California Press, Los Angeles 1999, S. 25
ebd., 31
ebd., S.1
René Stettler, ebd., Einführung
»Digital selection and analogue amplification coexist in a cortex-inspired
silicone circuit.«, Hahnloser u.a.., Zeitschrift ›Nature‹,
Vol 405, 22. Juni 2000, S. 947
Dr. Wolfgang Stieler, in: C’T, Neuronen aus Silizium, Heft 14/2000, S.51
Friedrich Kittler, Grammophon Film Typewriter, Berlin 1986 S. 54
Dr. Wolfgang Stieler, ebd., S. 51
Potter, S. M., Fraser, S. E. und Pine, J., Animat in a Petri Dish: Cultured
Neural Networks for Studying Neural Computation. Proceedings of the 4th Joint
Symposium on Neural Computation, UCSD, 1997, S. 167-174.
Rita Carter, ebd., S. 113
Heinz Emigholz, Krieg der Augen, Kreuz der Sinne, Verlag Martin Schmitz, Kassel
1991
Narayanan, Rizzo, Edell, Wyatt, Development of a Silicon Retina Implant. Investigative
Ophthalmology and Visual Science, Vol. 35, No.4, April 1994, S. 1380
aus einem Interview des Autors mit Rolf Eckmiller, Juni 2000
›Pixelvision 2000‹ ist eine Spielzeugkamera von Fischer Price, die
ein kleines s/w Bild auf einem Musikkasetten-Tape speichert. Anfang der 90er
zum Kultobjekt einer neuen Videoguerilla-Szene avanciert.
Jean-Pierre Changeux, Der Neuronale Mensch, Reinbek 1984, S.170
Ein Datenbankksystem hat sich diesen visuellen Erkennungsprozeß als
eine wirksame Methode zunutze gemacht, um das Problem der Speicherplatzlimitierung
zu umgehen: Um auf einem mit Magnetstreifen bedruckten Ausweis ein Porträt
abbilden zu können, hat man einen Klicheekatalog aus einer begrenzten
Anzahl verschiedener Gesichtsmerkmale angelegt, aus dem die Porträts
zusammengebaut werden.
Gilles Deleuze, The Time Image, übersetzt ins Englische von Hugh Tomlinson
und Robert Galeta, Minneapolis, 1989, S. 156
Auch vice versa untersucht Deleuze das »Kino des Gehirns«, Allegorien,
die die Funktionalität des Hirn in einer narrativen Handlung einbetten,
Kubrick’s Monolyth in ›2001‹, das Hotel in ›Shining‹,
etc. Deleuze, ebd., S. 206
Ken Jacobs ›Nervous System‹-Performance ist ein Sehmanipulator und
Deleuze’sche Kristallisation par excellence: Ein Bild wird durch Flickerfrequenzen
einer rotierenden Vektorenblende mit seinem eigenen (zeitversetzten) Gegenbild
verwoben und erst im Hirn wieder zu einem einzigen Bild zusammengesetzt.
Patricia Pisters, From Eye to Brain: Reconfiguring the Subject in Film Theory,
Einführung, University of Amsterdam ,
http://www.hum.uva.nl/~ftv/faculty/Patricia/deleuze.html
Peter Weibel, Über Genetische Kunst. Ars Electronica, Katalog 1993 und
www.aec.at/fest/fest93/hene.html